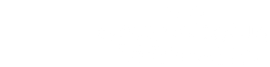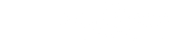Holzanatomie

Es ist immer gut, die Materialien zu kennen, mit denen man arbeitet. Beim Holzschnitzen gilt: Je mehr man über Holz weiß, desto besser wird das Ergebnis. In diesem Blog möchten wir Ihnen die Anatomie von Holz näherbringen.
Holzanatomie
Die Maserung eines Holzstücks beeinflusst jeden Schnitt bei jeder Schnitzerei. Die Schnittrichtung bestimmt, ob ein sauberer, glänzender Schnitt entsteht oder ein Schnitt, der aussieht, als wäre das Holz aus dem Stück gerissen.
Wenn Sie die Anatomie eines Baumes verstehen, können Sie das Ergebnis jedes Schnitts besser einschätzen. Mit diesem Wissen können Sie mit dem Holz arbeiten, anstatt dagegen, und so mehr Freude am Schnitzen haben.
Wenn Sie die Anatomie eines Baumes verstehen, können Sie das Ergebnis jedes Schnitts besser einschätzen. Mit diesem Wissen können Sie mit dem Holz arbeiten, anstatt dagegen, und so mehr Freude am Schnitzen haben.
Sichtbare Teile eines Baumes
Die drei Hauptbestandteile eines Baumes sind Wurzeln, Stamm und Krone.

Wurzeln: Wurzeln sind der Anker des Baumes und halten ihn aufrecht. Sie nehmen Wasser und Mineralien aus der Erde auf und transportieren diese über strohähnliche Gefäße durch den Stamm bis zur Baumkrone.
Stamm: Der Stamm, auch Stamm genannt, verbindet die Wurzeln mit der Krone und wird üblicherweise als der Teil ohne Äste angesehen. Zum Schnitzen kann Holz von jedem Teil eines Baumes verwendet werden; das meiste Schnitzholz stammt jedoch vom Stamm des Baumes.
Krone: Die Krone besteht aus Ästen, Zweigen und Blättern des Baumes. In den Blättern wird durch Photosynthese Nahrung, sogenannter Saft, produziert.
Interne Holzstrukturen
Die Wurzeln, der Stamm und die Krone sind die sichtbaren Bestandteile eines Baumes. Durch die Untersuchung seiner inneren Merkmale können wir jedoch seine Struktur besser verstehen.
Mark: Im Zentrum des Baumes befindet sich das Mark, der älteste Teil des Baumes. Das Mark wird zusammen mit den ersten Jahresringen des Baumes als Jungholz bezeichnet. Der Markbereich neigt stärker zum Reißen als das restliche Holz eines Baumes.
Vermeiden Sie das Schnitzen von Holzstücken, die Mark enthalten. Wenn Sie Holz mit Mark schnitzen, gestalten Sie das Stück so, dass das Mark aus dem Betrachtungswinkel nicht sichtbar ist.
Jahresringe: Vom Mark ausgehend verlaufen die Jahresringe. Jeder Ring besteht aus zwei Komponenten: Frühholz (auch Frühlingsholz genannt) und Spätholz (auch Sommerholz genannt).
Frühholz wächst zu Beginn der Wachstumsperiode – der Phase des aktiven Wachstums des Baumes. Dieses Holz besteht aus großen Zellen mit dünnen Wänden. Im weiteren Verlauf der Saison verlangsamt sich das Wachstum, die Zellen werden kleiner und dicker; man spricht von Spätholz. Spätholz ist aufgrund seines höheren Zellulosegehalts in der Regel dunkler als Frühholz. Normalerweise ist für jedes Wachstumsjahr ein Jahresring sichtbar. Die Breite der Ringe kann je nach Witterung und anderen Bedingungen während der Wachstumsperiode variieren.
Wenn ein Baum zum Schnitzen oder Drechseln in Bretter oder Blöcke geschnitten wird, entsteht die schöne Figur, die Sie sehen, durch die Jahresringe.
Kambiumschicht: Die Kambiumschicht befindet sich zwischen Rinde und Holz. Hier findet die Zellteilung statt. Bei der Zellteilung entstehen entweder Holzzellen oder Rindenzellen.
Wenn ein Baum im Frühjahr oder Sommer gefällt wird, wenn die Zellteilung aktiv ist, spürt man direkt unter der Rinde eine rutschige, schleimige Stelle – die Kambiumschicht. Während dieser aktiven Wachstumsphase sind Rinde und Holz locker miteinander verbunden. Wenn das Holz trocknet, besteht daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Rinde abfällt. Im Herbst oder Winter, wenn die Zellteilung nur sehr eingeschränkt stattfindet, sind Holz und Rinde fest miteinander verbunden. Wenn Sie eine
Schnitzen, bei dem die Rinde intakt bleibt
Was das Holz betrifft, muss der Baum im Herbst oder Winter geerntet werden.
Rinde: Die Rinde ist die Schutzhülle des Baumes – seine Haut. Sie besteht aus lebenden und toten Zellen, die Feuchtigkeit und Gase im Baum speichern. Sie schützt den Baum außerdem vor Insekten und Mikroorganismen und vor schädlichen Witterungseinflüssen.
Kernholz und Splintholz: Während des Wachstums eines Baumes wird irgendwann nicht mehr der gesamte Stamm benötigt, um die Blätter mit Wasser zu versorgen. In diesem Fall füllen sich die Gefäße im Inneren des Baumes mit Extrakten, Mineralien und Tanninen. Dieser gefüllte Bereich wird dann zum sogenannten Kernholz.
Mark: Im Zentrum des Baumes befindet sich das Mark, der älteste Teil des Baumes. Das Mark wird zusammen mit den ersten Jahresringen des Baumes als Jungholz bezeichnet. Der Markbereich neigt stärker zum Reißen als das restliche Holz eines Baumes.
Vermeiden Sie das Schnitzen von Holzstücken, die Mark enthalten. Wenn Sie Holz mit Mark schnitzen, gestalten Sie das Stück so, dass das Mark aus dem Betrachtungswinkel nicht sichtbar ist.
Jahresringe: Vom Mark ausgehend verlaufen die Jahresringe. Jeder Ring besteht aus zwei Komponenten: Frühholz (auch Frühlingsholz genannt) und Spätholz (auch Sommerholz genannt).
Frühholz wächst zu Beginn der Wachstumsperiode – der Phase des aktiven Wachstums des Baumes. Dieses Holz besteht aus großen Zellen mit dünnen Wänden. Im weiteren Verlauf der Saison verlangsamt sich das Wachstum, die Zellen werden kleiner und dicker; man spricht von Spätholz. Spätholz ist aufgrund seines höheren Zellulosegehalts in der Regel dunkler als Frühholz. Normalerweise ist für jedes Wachstumsjahr ein Jahresring sichtbar. Die Breite der Ringe kann je nach Witterung und anderen Bedingungen während der Wachstumsperiode variieren.
Wenn ein Baum zum Schnitzen oder Drechseln in Bretter oder Blöcke geschnitten wird, entsteht die schöne Figur, die Sie sehen, durch die Jahresringe.
Kambiumschicht: Die Kambiumschicht befindet sich zwischen Rinde und Holz. Hier findet die Zellteilung statt. Bei der Zellteilung entstehen entweder Holzzellen oder Rindenzellen.
Wenn ein Baum im Frühjahr oder Sommer gefällt wird, wenn die Zellteilung aktiv ist, spürt man direkt unter der Rinde eine rutschige, schleimige Stelle – die Kambiumschicht. Während dieser aktiven Wachstumsphase sind Rinde und Holz locker miteinander verbunden. Wenn das Holz trocknet, besteht daher eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Rinde abfällt. Im Herbst oder Winter, wenn die Zellteilung nur sehr eingeschränkt stattfindet, sind Holz und Rinde fest miteinander verbunden. Wenn Sie eine
Schnitzen, bei dem die Rinde intakt bleibt
Was das Holz betrifft, muss der Baum im Herbst oder Winter geerntet werden.
Rinde: Die Rinde ist die Schutzhülle des Baumes – seine Haut. Sie besteht aus lebenden und toten Zellen, die Feuchtigkeit und Gase im Baum speichern. Sie schützt den Baum außerdem vor Insekten und Mikroorganismen und vor schädlichen Witterungseinflüssen.
Kernholz und Splintholz: Während des Wachstums eines Baumes wird irgendwann nicht mehr der gesamte Stamm benötigt, um die Blätter mit Wasser zu versorgen. In diesem Fall füllen sich die Gefäße im Inneren des Baumes mit Extrakten, Mineralien und Tanninen. Dieser gefüllte Bereich wird dann zum sogenannten Kernholz.
Das Kernholz leitet kein Wasser mehr, ist aber mit Extrakten und Mineralien gefüllt und verleiht dem Baum dadurch Festigkeit. Es bildet die Wirbelsäule des Baumes. Der Bereich, der noch Wasser zu den Blättern leitet, wird als Splintholz bezeichnet. Mit dem jährlichen Wachstum des Baumdurchmessers und dem Nachwachsen von neuem Splintholz vergrößert sich auch der Kernholzbereich, da jeder Baum nur eine bestimmte Anzahl von Splintringen benötigt, um die Blätter mit Wasser zu versorgen. Die Anzahl der Splintringe variiert von Baumart zu Baumart. Trompetenbäume benötigen nur wenige Splintringe, Walnussbäume hingegen 10 bis 20 Splintringe.
Auch die Farbdifferenzierung zwischen Splint- und Kernholz variiert je nach Baumart. Bei manchen Baumarten, wie zum Beispiel Walnuss, ist eine deutliche Farbdifferenzierung zwischen Kern- und Splintholz zu erkennen. Bei Linde und Butternuss hingegen ist die Farbdifferenzierung zwischen Kern- und Splintholz sehr gering. Die meisten Schnitzereien bestehen aus Kernholz.
Gefäße und Strahlen: Wenn man den Querschnitt eines Laubbaums unter dem Mikroskop betrachtet, ist es, als würde man in das Ende eines großen Bündels Strohhalme schauen.
Diese Halme sind die Gefäße, die vertikal durch den Baum verlaufen und Wasser und Mineralien von den Wurzeln durch den Stamm bis zu den Blättern transportieren. In den Blättern wird durch Photosynthese Nahrung (der sogenannte Saft) für das Wachstum und die Ernährung des Baumes produziert. Der Saft wird durch Zellen direkt unter der Rinde (dem Phloem) zurück in den Baum transportiert und durch Leitstrahlen horizontal im Baum verteilt. Die Leitstrahlen sind schwache, dünnwandige Zellen, die sich zwischen und um die vertikalen Gefäße schlängeln.
Bei den meisten Holzarten sind diese Strahlen nur bei Vergrößerung sichtbar. Sie verbinden die vertikalen Gefäße miteinander, sind aber bei weitem nicht so stark wie die Gefäßwände. Drängt man einen keilförmigen Gegenstand wie ein Messer oder einen Hohleisen zwischen die Gefäße, reißen die Strahlenzellen und die Gefäße spalten sich voneinander. Dies nennt man Spaltung in Faserrichtung.
Es ist wichtig zu wissen, wie die Gefäße auseinander reißen, da dies jeden Schnitt des Schnitzers beeinflusst. Ihr Ziel sollte es sein, jeden Schnitt quer über die Gefäße zu führen, um die Kontrolle über den Schnitt zu behalten. Geben Sie den Schnitzwerkzeugen niemals die Möglichkeit, zwischen die Gefäße zu gelangen und diese dadurch auseinanderzureißen.
Auch die Farbdifferenzierung zwischen Splint- und Kernholz variiert je nach Baumart. Bei manchen Baumarten, wie zum Beispiel Walnuss, ist eine deutliche Farbdifferenzierung zwischen Kern- und Splintholz zu erkennen. Bei Linde und Butternuss hingegen ist die Farbdifferenzierung zwischen Kern- und Splintholz sehr gering. Die meisten Schnitzereien bestehen aus Kernholz.
Gefäße und Strahlen: Wenn man den Querschnitt eines Laubbaums unter dem Mikroskop betrachtet, ist es, als würde man in das Ende eines großen Bündels Strohhalme schauen.
Diese Halme sind die Gefäße, die vertikal durch den Baum verlaufen und Wasser und Mineralien von den Wurzeln durch den Stamm bis zu den Blättern transportieren. In den Blättern wird durch Photosynthese Nahrung (der sogenannte Saft) für das Wachstum und die Ernährung des Baumes produziert. Der Saft wird durch Zellen direkt unter der Rinde (dem Phloem) zurück in den Baum transportiert und durch Leitstrahlen horizontal im Baum verteilt. Die Leitstrahlen sind schwache, dünnwandige Zellen, die sich zwischen und um die vertikalen Gefäße schlängeln.
Bei den meisten Holzarten sind diese Strahlen nur bei Vergrößerung sichtbar. Sie verbinden die vertikalen Gefäße miteinander, sind aber bei weitem nicht so stark wie die Gefäßwände. Drängt man einen keilförmigen Gegenstand wie ein Messer oder einen Hohleisen zwischen die Gefäße, reißen die Strahlenzellen und die Gefäße spalten sich voneinander. Dies nennt man Spaltung in Faserrichtung.
Es ist wichtig zu wissen, wie die Gefäße auseinander reißen, da dies jeden Schnitt des Schnitzers beeinflusst. Ihr Ziel sollte es sein, jeden Schnitt quer über die Gefäße zu führen, um die Kontrolle über den Schnitt zu behalten. Geben Sie den Schnitzwerkzeugen niemals die Möglichkeit, zwischen die Gefäße zu gelangen und diese dadurch auseinanderzureißen.
Das Wissen anwenden
Jede Schnitzerei enthält Übergangspunkte, an denen Sie die Schnittrichtung ändern müssen. Ein negativer Übergangspunkt ist der Bereich, auf den Sie zuschneiden müssen. Ein positiver Übergangspunkt ist der Bereich, von dem Sie wegschneiden müssen. Sie müssen in die richtige Richtung schneiden, damit das Werkzeug nicht zwischen die Gefäße gerät.
Wenn Sie in die falsche Richtung schneiden, neigt das Holz zum Splittern. Ich kann Ihnen nur eindringlich genug betonen, wie wichtig es ist, Holz so zu schneiden, dass Ihre Schnitzwerkzeuge nicht zwischen die Maserungen geraten. Wenn Sie die Maserungsrichtung eines Holzstücks nicht deutlich erkennen können, drücken Sie das Werkzeug leicht in das Holz. Wenn das Werkzeug zwischen die Maserung (die Maserung des Holzes) gelangen möchte, schneiden Sie in die falsche Richtung. Für einen sauberen Schnitt müssen Sie den Schnitt in die andere Richtung ausführen.
Am besten lernt man durchs Tun. Diese einfache Übung zeigt, wie man mit der Holzmaserung sowie negativen und positiven Übergangspunkten arbeitet. Schneiden Sie immer von einem positiven Übergangspunkt weg und auf einen negativen Übergangspunkt zu.
Wenn Sie in die falsche Richtung schneiden, neigt das Holz zum Splittern. Ich kann Ihnen nur eindringlich genug betonen, wie wichtig es ist, Holz so zu schneiden, dass Ihre Schnitzwerkzeuge nicht zwischen die Maserungen geraten. Wenn Sie die Maserungsrichtung eines Holzstücks nicht deutlich erkennen können, drücken Sie das Werkzeug leicht in das Holz. Wenn das Werkzeug zwischen die Maserung (die Maserung des Holzes) gelangen möchte, schneiden Sie in die falsche Richtung. Für einen sauberen Schnitt müssen Sie den Schnitt in die andere Richtung ausführen.
Am besten lernt man durchs Tun. Diese einfache Übung zeigt, wie man mit der Holzmaserung sowie negativen und positiven Übergangspunkten arbeitet. Schneiden Sie immer von einem positiven Übergangspunkt weg und auf einen negativen Übergangspunkt zu.